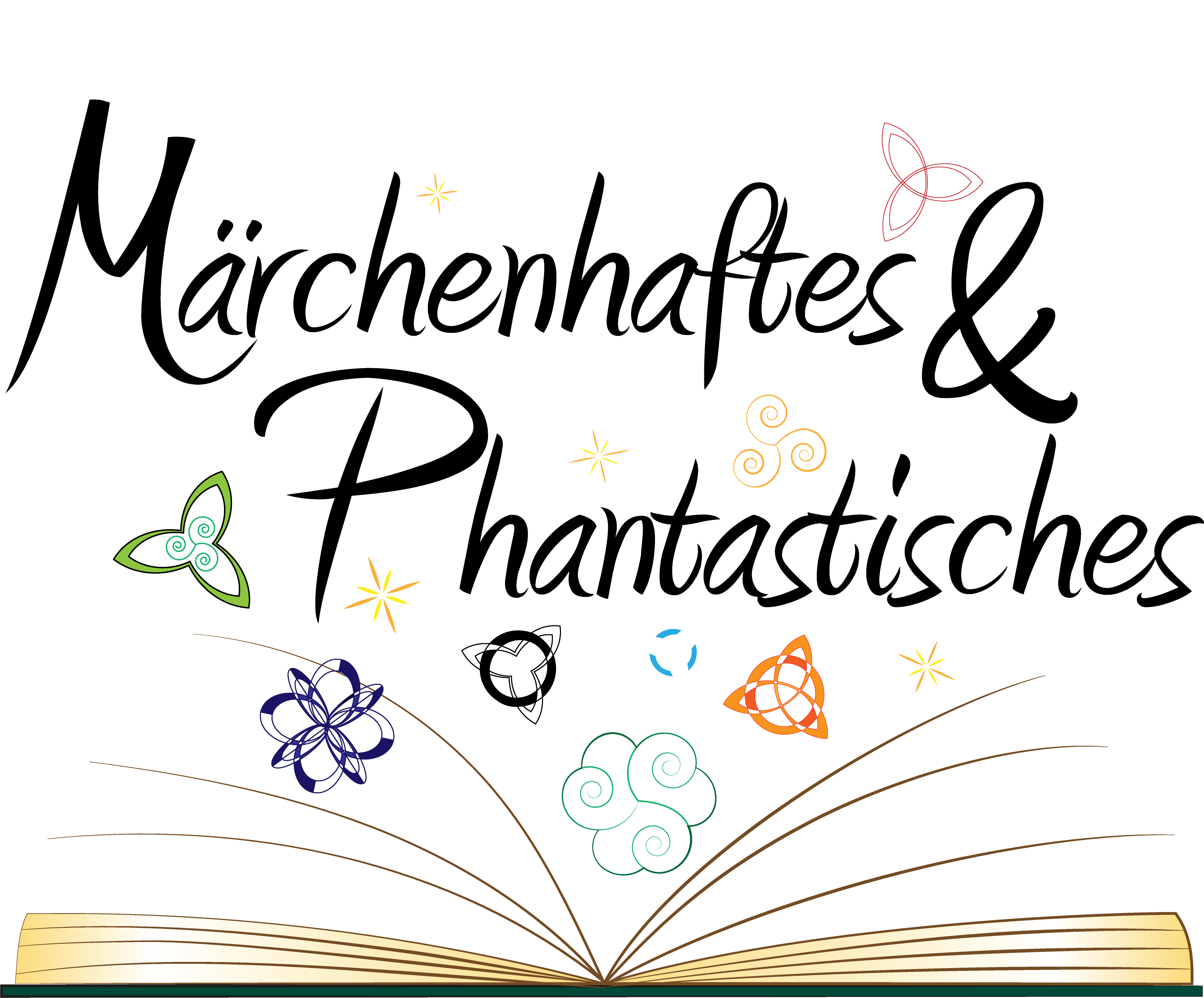Myalig – gestohlene Leben
Myalig - gestohlene Leben
1. Kapitel – Abschied
Schlamm und Dreck spritzten unter meinen Füßen auf. War es der Regen oder waren es meine Tränen, die das Bild der reifenden Weinreben vor meinen Augen verschwimmen ließ? So sehr ich den Weinberg sonst liebte, heute stimmte er mich traurig. Die Ernte würde verloren sein, wenn es nicht bald aufhörte zu schütten. Andererseits: Falls der Androide dieses Grafen von Sonnfried recht hatte, dann war bereits jetzt alles verloren.
Der Regen peitschte mir ins Gesicht, vermischte sich mit meinen Tränen. Das konnte unmöglich wahr sein!
»Beeil dich, Amanda«, sagte ich zu mir und den Weinstöcken. »Erfüll Vater seinen letzten Wunsch.«
Tief atmete ich ein und betrachtete die hügelige Landschaft. Normalerweise trösteten mich die Weinberge oder brachten mich auf andere Gedanken. Heute waren sie nur matschig, trist und leer. Bald würden Wildkräuter alles überwuchern und niemand würde mehr zwischen den Reben entlanggehen.
Im Vorbeigehen streifte ich die jungen Weintrauben, patschte durch die Pfützen, tropfnass am ganzen Körper. Mittlerweile waren meine Schuhe nicht mehr zu retten und an meinem Kleid gab es keine trockene Stelle mehr.
Doch darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen. Ich musste unseren Weinberg erreichen und die Stecklinge für meinen Vater holen.
Fortgehen. Das hatte er gesagt. Mit den Pflanzen sollte ich in der Ferne ein neues Leben anfangen. Alles in mir zog sich bei dem Gedanken zusammen. Meine Heimat verlassen zu müssen … Ich schüttelte den Kopf. Die Weinberge und meine Familie würde ich nach dem heutigen Tag nie wiedersehen.
Endlich erreichte ich unseren Abschnitt des Hanges. Ich zog ein Messer aus meiner Rocktasche und schnitt mehrere junge Triebe ab. Dabei achtete ich darauf, von jeder Sorte mindestens zwei zu erwischen. Zügig lief ich durch die Reihen und sammelte das Vermächtnis meines Vaters ein.
Plötzlich hörte ich über mir das Dröhnen von Luftschiffmotoren. Tief duckte ich mich zwischen die Reben, kniete mich in den Matsch. Die Stecklinge legte ich vor mich auf den Boden. War das Militär bereits so nah?
Mein Herz pochte wild. Ich suchte die Straße zwischen den Weinbergen mit den Augen ab. Noch wanderten keine Soldaten in Richtung Rebenau, aber mein Vater glaubte dem Androiden. Sie würden kommen und jeden töten, dessen Bluttest positiv ausfiel.
Das Luftschiff flog über mich hinweg. Der Wind peitschte in mein Gesicht, zerrte an meinen Haaren. Vielleicht hatten wir Glück und wurden verscho…
Ein schriller Pfiff durchschnitt das Prasseln des Regens. Der Zeppelin in den weiß-roten Farben des Militärs setzte zur Landung an. Nicht weit von Rebenau, aber näher an unserem Nachbardorf.
Schwer schluckend rappelte ich mich auf. Ich durfte nicht trödeln. Ich sammelte die Stecklinge ein und lief zurück.
Reihe für Reihe zogen sich die Rebstöcke den Hügel hinab. Dann trafen sie auf den Weg, der die Weinfelder vom Dorf trennte. Ein Fachwerkhaus neben dem anderen duckte sich zwischen den Hügeln. Früher glaubte ich, die Häuser würden wie Celia und ich Verstecken spielten.
Celia. Allein der Gedanke an sie ließ mich die nächsten Schritte stolpern. Drei Tage lag ihr Tod zurück. Viel zu früh war sie gegangen. Nur eine Woche nach ihrem dreißigsten Geburtstag.
»Ach Celia …« Was hätte ich dafür gegeben, nun ihr Lachen hinter mir zu hören. Ihre beruhigenden Worte, dass es sicherlich andere Gründe für die Landung des Zeppelins gab. Aber es konnte nicht sein. Myalig. Die unsichtbare Seuche war überall. Und nun kam das Militär, um die weitere Verbreitung einzudämmen.
Laut rief ich über den Regen hinweg in Richtung der Soldaten: »Mich werdet ihr nicht bekommen!« Stattdessen würde mich der Graf von Sonnfried bei sich aufnehmen, damit ich ihn bei der Erforschung eines Heilmittels unterstützen konnte. Dafür hatte mein Vater gesorgt. Denn im Gegensatz zu meiner Schwester hatte ich Myalig überlebt und meine Lebensenergie zurückgewonnen, was an ein Wunder grenzte. Niemand hatte bisher überlebt!
In den Zeitungen wurde ich aber mit keinem Wort erwähnt. Nur Celias Tod wurde betrauert. Bei mir konnten sich die Ärzte nicht erklären, weshalb ich gesund wurde; deshalb beschlossen sie, lieber keine falschen Hoffnungen zu wecken. Sicherer war es, wenn alle Menschen sich von den Erkrankten fernhielten. Ich wusste das nur zu gut, denn meine Mutter spürte bereits den ermüdenden Griff der Krankheit. Viel schlimmer war nur, welche Konsequenzen mein Vater nun daraus zog. Er wollte lieber sein Leben vorzeitig beenden lassen, als andere anzustecken. Auch meinen Bruder sowie meine Mutter zwang er in diesen Tod.
Bei dem Gedanken schossen mir wieder die Tränen in die Augen. Ich wollte meine Familie nicht zurücklassen!
Aber mein gerade zurückgewonnenes Leben beenden wollte ich noch weniger. Daher tastete ich nach den sattgrünen Blättern der Stecklinge, schüttelte das Wasser von ihnen. Schüsse aus dem Nachbardorf hallten bereits über den Berg. Viel Zeit blieb nicht.
Der Schauer ließ nach und ging in einen angenehmen Nieselregen über. Dennoch zitterte ich vor Kälte und Angst. Mit gerafften Röcken, die Stecklinge fest umklammert, rannte ich weiter nach Hause.
Das nasse Gras mit der aufgewühlten Erde brachte mich hin und wieder ins Rutschen. Dann endlich betrat ich den Feldweg. Mit einem unangenehmen Kribbeln in der Magengegend lief ich zwischen den Häusern hindurch. Es fühlte sich komisch an, alles zum letzten Mal zu sehen, in dem Wissen, dass in wenigen Stunden hinter diesen Mauern niemand mehr atmen würde. Die Tropfen, die von den Fensterscheiben abperlten, waren wie ein düsterer Bote, der seine Tränen vorausschickte. Ebenso wie das Rinnsal auf dem Feldweg, das hangabwärts floss.
Zum Glück war keiner der Nachbarn zu sehen. Sie alle wären in Panik ausgebrochen und weniger vernünftig gewesen als meine Familie. Nur zu gut erinnerte ich mich an ihre Worte seit Celias Tod.
»Der Wein ist verseucht, trinkt ihn bloß nicht!«
»Bestimmt waren die Reben zu alt und kraftlos. Das hat sich übertragen.«
»Passt auf, haltet euch fern von den Buchherbsts. Sie sind der Tod auf Beinen.«
Immer wieder hatte ich Menschen auf dem Markt tuscheln hören. Uns hängten sie die Seuche an; dabei waren auch viele ihrer Verwandten und Freunde erkrankt.
Doch augenblicklich verflog meine Wut auf sie. Im Gegensatz zu ihnen konnte ich mir an einem anderen Ort ein neues Leben aufbauen. Diese Chance bekamen sie nicht. Das machte mich noch trauriger.
Mit gesenktem Kopf stapfte ich durch die Pfützen und bog in den Hintereingang zu unserem Hof ein. Ich drückte mich besonders dicht an die Wand, damit die alte Brauner nicht auf mich aufmerksam wurde.
Schuldgefühle stiegen wieder in mir hoch. Wie konnte ich fliehen und alle anderen hier zurücklassen?
Ich schlüpfte durch die Holztür zu unserem Hof. Die Lagergebäude über mir sperrten den Regen aus. Im Eingang stand mein Bruder Edwin mit vor der Brust verschränkten Armen. »Was dauert das so lange, Amanda? Mach verdammt nochmal, dass du hier wegkommst!« Er trat auf mich zu, baute sich vor mir auf und pikste mit dem Finger gegen meine Brust. »Du solltest dich schämen! Vater ist bereits wahnsinnig vor Sorge! Wir haben erste Schüsse gehört und du trödelst nur!« Er nahm mir die Stecklinge ab und zerrte mich aus dem Durchgang in Richtung Innenhof.
Ich verdrehte die Augen. »Wie schnell kannst du bei dem Wetter hin- und zurücklaufen?«
»Du weißt, was auf dem Spiel steht und dennoch träumst du wieder nur vor dich hin!« Ohne Luft zu holen, redete er auf mich ein, meinte, er wäre schneller gewesen und überhaupt …
Selbst jetzt konnte er in mir nur die kleine Schwester sehen. Wenn er nicht gerade betrunken war oder eines der leicht zu habenden Mädchen an seinem Arm hing, hatte er nichts Besseres zu tun, als mit mir zu schimpfen. Mit anderen sprach er vernünftig, wohlwollend. Vor allem bei unseren Kunden war er dadurch beliebt. Aber ich war seine kleine, fünfundzwanzigjährige Schwester und die durfte er herumschubsen. Von wegen! »Du hättest genauso gut gehen können! Dann hätte ich im Trocknen die Töpfe für die Stecklinge vorbereitet und bräuchte mich vor der Abreise nicht umziehen!«, brach es verärgert aus mir heraus. Aber sogleich verrauchte meine Wut. Nie wieder würden wir streiten können. So wollte ich mich nicht verabschieden.
»Gibst du mir nun die Schuld, dass du nass bist?« Er kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Dann schnalzte er mit der Zunge. »Sieh zu, dass du dir etwas Ordentliches anziehst. So kannst du unmöglich dem Androiden und später Graf Levente unter die Augen treten. Noch schlimmer, wenn Mutter dich sieht … Tue ihr wenigstens den Gefallen, vor ihrem Tod noch ein letztes Mal ihre Tochter in einem gepflegten Zustand zu sehen.« Ein ängstlicher Schatten lag in seinem Blick, als er den Kopf senkte und auf die Stecklinge in seiner Hand starrte.
Am liebsten hätte ich ihn in die Arme geschlossen und den Zwist zwischen uns vergessen … Nur war ich zu langsam. Er wandte sich von mir ab und machte es mir unmöglich, ihm die Hand zu reichen. Also lief ich über den Hof zur Treppe, die zu Celias und … Ich korrigierte mich: Die zu meinem Zimmer hinaufführte. Als ich die Stufen erklomm, spürte ich Edwins Blick in meinem Rücken. Fühlte er ebenso wie ich?
Später würde ich ihm zeigen, dass ich ihm verzieh, wie er mich früher behandelt hatte. Das war ich ihm schuldig. Immerhin musste er bleiben.
Ich stieß die Tür zum Zimmer auf und sah mich hektisch um. Nicht einmal in Ruhe packen konnte ich. Reisekleidung anziehen und los, hatte mein Vater gesagt. Der Androide hatte ihm beigepflichtet, als er vor nicht einmal einer Stunde bei uns angekommen war. Keiner von uns wusste, wann das Militär in Rebenau einfallen würde. Vorher sollten der Nicht-Mensch und ich verschwunden sein. Aber wenigstens ein Andenken an meine Heimat wollte ich mitnehmen.
Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen. Bald waren beide Betten leer. Das Lachen in unserem Raum war schon mit Celias Erkrankung verstummt. Nur noch einige Aquarelle an den Wänden erinnerten an sie. Wir hatten die kostbaren Farben so zart aufgetragen, dass die Sonne die Motive beinahe verblasst hatte. Ganz anders bei den beiden Bildern in der Mitte. Die Weinberge.
Lachend hatten wir auf dem Dach vom Schuppen gesessen, hatten unsere Pinsel abwechselnd in das Wasserglas getunkt und über das Papier gestrichen. Manchmal über das Blatt der anderen. Ein herrlicher Sommertag vor zwei Jahren war es gewesen, als alles noch in Ordnung war. Voller Wärme und Nähe. Für mich eine wertvolle Erinnerung an meine Schwester, an meine Heimat. Also nahm ich die Bilder von der Wand.
Ich klemmte mir die Rahmen unter den Arm und legte sie dann auf mein Bett. Die Tagesdecke war noch immer voller Haare von unserer Katze. Bald würde Mina sich wahrscheinlich einen anderen Schlafplatz suchen.
Dann zog ich die nassen Stiefel aus, hängte die Socken über den Schaft. Barfuß stapfte ich zu unserem Kleiderschrank hinüber.
»Was ziehe ich bloß an?« Ungeduldig schob ich ein Teil nach dem anderen zur Seite. Ein ähnliches Kleid, wie ich es im Augenblick trug, wollte ich auf keinen Fall für die Reise anziehen. Viel zu unpraktisch. Dann lieber eine der modernen Hosen, die Celia noch letztes Jahr getragen hatte. Ich fand zwar die abgelegten Arbeitshosen von Edwin angenehmer, aber die Pluderhose von Celia würde meiner Mutter sicher besser gefallen. Ihr musste ich den Abschied wirklich nicht noch schwerer als nötig machen.
Auch eine passende Bluse, ein nettes Tuch für den Hals und einen Ledergürtel schnappte ich mir von Celias Sachen. Bei der Unterkleidung blieb ich bei meinen eigenen Stücken. Da wusste ich, dass sie passten. Die Korsetts von Celia waren mir zu eng an der Taille und zu weit an der Brust.
Ich legte die Sachen auf mein Bett und zog mich aus. Sobald die nassen Stoffe zu Boden fielen, wurde mir bereits wärmer. Die Dachkammer war gut aufgeheizt und so trocknete meine Haut schnell.
Bestenfalls würde meine Mutter ignorieren, wie ich aussah. Wahrscheinlicher war, dass sie in Tränen ausbrach und wieder wünschte, ich hätte den Platz mit Celia getauscht. Das wollte ich uns beiden nicht antun. Ich wusste, dass sie es nicht böse meinte. Auch sie war krank. Celia war zwar ihr Liebling gewesen, dennoch liebte sie auch Edwin und mich auf ihre Art.
Mit einem Seufzer zog ich die Kleidung meiner Schwester an. Es fühlte sich komisch an, als ob ich nicht ich selbst wäre. Aber so konnte ich wenigstens reisen und sah nicht wie ein Dorftrottel aus. Nun brauchte ich nur noch meine Haare in Ordnung zu bringen.
Ich schnappte mir die Bürste, zog die Zinken ziepend durch meine braunen Strähnen. Keine Chance. Die wirren Locken waren zu dick. Also blieb mir nichts anderes übrig, als sie zu einem losen Zopf zu flechten.
Zufrieden trat ich vom Spiegel zurück. Es würde ausreichen.
Mir selbst Mut machend, nickte ich meinem Spiegelbild zu. »Ich werde überleben und Vaters Wunsch erfüllen. Wir werden rechtzeitig Rebenau verlassen.« Ich verzog den Mund, denn es klang wenig überzeugend. Das Selbstbewusstsein meiner Schwester fehlte mir.
Ich wollte keinen Abschied, wollte Vater und Mutter nicht verlassen. Aber eine Wahl blieb mir nicht. Schweren Herzens griff ich nach meiner Umhängetasche, stopfte mein Skizzenbuch und einige Farben hinein. Die Bilder umwickelte ich mit einem Schal von Celia, um sie vorsichtig in der Tasche zu verstauen.
Mein Kleid und die Schuhe ließ ich dort, wo ich sie ausgezogen hatte, und schlüpfte in Celias Stiefel, auch wenn sie mir ein wenig zu groß waren. Immerhin waren sie sauber und trocken. Beim Hinausgehen griff ich meinen Mantel.
Als die Tür hinter mir ins Schloss fiel, hatte ich das Gefühl, mich endgültig von Celia und meinem bisherigen Leben zu verabschieden. Bis jetzt hatte sie in meinen Gedanken an meiner Seite gelebt, doch nun …
Mir blieb nur noch ihr Bild.